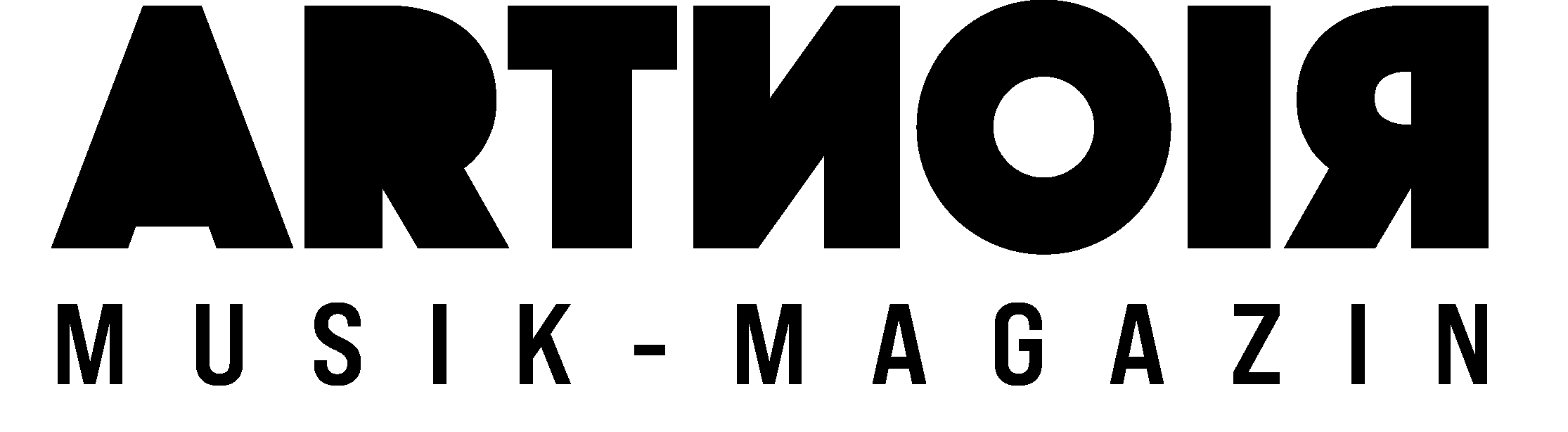19. Dezember 2017
19. Dezember 2017
Im Gespräch mit: Thomas Mars von Phoenix
Phoenix zählen zu den erfolgreichsten Bands aus Frankreich. Angefangen haben sie als Teenager in den 90er Jahren in Versailles; mit „Wolfgang Amadeus Phoenix“ kam 2009 der internationale Durchbruch. Im Juni 2017 erschien ihr sechstes Album „Ti Amo“, ein Indie-Pop-Juwel mit sommerlichen Temperaturen und nostalgischen Erinnerungen an das Italien der 80er Jahre. Am Mittwoch, 21. März 2018 kommen Phoenix ins Volkshaus Zürich. Sänger Thomas Mars erzählt von Soundtüfteleien und Kaugummi im Haar.
Anna: Ihr deckt zu viert den Gesang, die Gitarre, die Keyboards und den Bass ab – aber einige Jahre lang gab es bei Phoenix keinen offiziellen Schlagzeuger. Du warst mal Schlagzeuger, und jetzt ist Thomas Hedlund mit dabei. Habt ihr euch am Anfang nie gefragt, „Moment mal, wir brauchen einen Schlagzeuger“?
Thomas: Am Anfang war ich der offizielle Schlagzeuger und wir hatten keinen Sänger. Niemand wollte singen und im Rampenlicht stehen. Das war das Schöne an der Band – wir waren einfach glücklich, zusammen Musik zu machen. Es war etwas schüchtern von uns, dass niemand singen wollte. Ich fing an zu singen, während ich Schlagzeug spielte, was immer schwierig und unglamourös ist. In Ermangelung eines anderen Kandidaten wurde ich also der Sänger.
Dann bist du über die Jahre hinweg in die Frontmann-Rolle hineingewachsen?
Ja, auf jeden Fall. Ich liebte es zu trommeln, und es gab Schlagzeuger, die ich mochte, aber als Kind hatte ich kein Vorbild. Aber es gab Sänger, die ich bewunderte. Ich liebte zum Beispiel Prince – er war überwältigend gut. Prince war ein Freak im besten Sinne; ein Virtuose an jedem Instrument. Und dann fing ich an, mich mit anderen Sängern zu identifizieren. Leute, die zwar nicht so gut waren wie Prince, aber bei denen ich zum Beispiel die Art, wie sie das Mikrofon hielten, kopierte. Ich konnte verschiedene Dinge kopieren, um letztlich meinen eigenen Stil zu finden.
Ihr seid alle mehrsprachig, aber warum singt ihr – nicht immer, aber meistens – auf Englisch?
Ich denke, das gibt uns etwas Neues. Die Tatsache, dass wir Franzosen sind und Texte auf Englisch schreiben – je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es fast eine Umkehrung der Yéyé-Ära ist. Yéyé war eine Ära in den 60er Jahren in Frankreich. Es war eine Generation, die von der amerikanischen Kultur fasziniert war. Johnny Hallyday war Teil des Yéyé. Diese Musiker liebten Amerika so sehr, dass sie nicht einmal ihr eigenes Material erfanden. Sie übersetzten einfach amerikanische Klassiker ins Französische.
Ich denke, wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben die Sprache übernommen, aber nicht die ganze Ästhetik und den ganzen Sound. Anstatt über Palmen und Kaugummi zu sprechen, sprachen wir über unser Leben in Paris und Versailles. Wir schafften damit etwas Neues und konnten gleichzeitig der kleinen Welt von Versailles und Paris entkommen. Es war Musik, die uns an andere Orte entführte.
Euer früherer Produzent Phillipe Zdar hat einmal gesagt, dass ihr als Band keine Fans davon seid, zu viel Hall zu verwenden. Ist das immer noch wahr?
Vieles, was eine Band charakterisiert, was die Identität eines Bandsounds ausmacht, ist einfach Glück oder Schicksal. Der Sound entsteht zufällig. Am Anfang konnten wir zwar in unseren Schlafzimmern Musik machen, aber wir hatten keine teuren Mikrofone, um einen grossartigen Schlagzeug-Sound aufzunehmen, also haben wir Drumcomputer oder Samples benutzt. Wir hatten einen billigen Kompressor – Daft Punk und Air hatten den gleichen. Und dieser Kompressor erzeugte einen Sound, der bei allen gleich klang, aber das war, weil es der billigste war und der einzige, den wir uns leisten konnten.
Bezüglich Halleffekt hatten wir für unser zweites Album plötzlich diese [besseren] Mikrofone und konnten ein Schlagzeug aufnehmen. Wir beschlossen, für die Aufnahme einen Raum zu bauen, und wir haben einfach viel zu viel Isoliermaterial an die Wand geklebt, weil wir nicht wollten, dass sich ein Nachbar beschwert. Das hat diesen extrem trockenen Raum geschaffen, und dadurch ein trockenes Album, das man laut abspielen muss, weil es keinen Hall hat.
Aber das kam nur, weil wir Amateure waren und nicht wussten, wie man einen Raum isoliert! Das hat einen einzigartigen Sound geschaffen. Ich denke, dass solche Dinge viel passieren, gerade weil man sie nicht „richtig“ oder nicht professionell macht.
Und ihr mochtet den Sound und habt so weitergemacht?
Ja, in der Zeit [um 2003] schien es eine gute Idee zu sein, Halleffekte wegzulassen, weil sie ausser Kontrolle geraten waren. Aber später verliebten wir uns in Halleffekte.
Als wir mal in Detroit waren, besuchten wir die Motown-Studios. Während des Besuchs gab es einen Raum, in dem das Dach offen war, und wir klatschten in diesem kleinen offenen Raum und hörten den Hall; es war magisch. Du hörst plötzlich jedes Album, das dort aufgenommen wurde – weil du den Hall hörst, der ein solch wichtiger Bestandteil all dieser Platten ist.
Gab es auf dem Album „Ti Amo“ spezifische neue Sounds – digital, analog, oder neue Instrumente – die ihr zusammen mit Produzent Pierrick Devin für das Album ausprobiert habt?
Ja, wir haben viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, wie wir mit unseren Instrumenten Charaktere erschaffen können. Ich habe zum Beispiel beim Gesang mit vielen Effekten herumgespielt. Manchmal wird dir deine eigene Stimme langweilig, und sowas hilft dann weiter. Du hast Effekte, die dir erlauben, eine Fantasieversion von dir selbst zu sein. Es ist wie bei einem Schauspieler, der ein Kostüm anzieht.
Das haben wir bei jedem Instrument so gemacht. Früher haben wir das fürs Schlagzeug gemacht, weil Drumcomputer das von Anfang an erlaubt haben. Und heute kannst du eine Gitarre in etwas verwandeln, das mehr wie eine Stimme klingt.
Mit unseren Instrumenten diese Verwirrung zu erzeugen, das ist sehr stimulierend für uns vier, weil es nicht darauf ankommt, wer was spielt oder welches Instrument welchen Teil macht. Es schafft eine elegante Unordnung.
Wer hat das Cover für „Ti Amo“ gestaltet?
Das hab ich gemacht. Wir wollten immer alles selbst machen, auch wenn es nicht der professionellste Weg war.
Ich telefonierte während drei Tagen viel mit Chris [Mazzalai, Gitarrist], weil wir uns alle Demos anhörten, die wir aufgenommen hatten. Ich zeichnete währenddessen vor mich hin, und drei Tage später zeichnete ich etwas, das mir gefiel. Ich schickte Chris ein Foto davon und er mochte die Idee, dass es etwas von uns war, statt dass wir einen Designer anfragten. Der Ausgangspunkt war also diese Zeichnung.
Und dann kam noch Warren Fu dazu, der ein Video für uns gedreht hatte und der grossartig ist. Es ist selten, dass du eine Vision hast für etwas und es jemandem gibst und es am Schluss besser ist als deine Vision. Warren treibt deine Ideen immer weiter. Er hat also auch eine grosse Rolle gespielt.
Du bist immer noch am Crowdsurfen! Wenn du ins Publikum gehst und auf den Schultern der Zuschauer stehst oder beim Balkon hoch- und runterkletterst, hast du dann nie Angst, dass dich das Publikum fallen lässt?
Nein. Ich habe Angst vor ein paar Dingen, aber da verliere ich niemals das Vertrauen. In diesem Moment sind alle Augen auf mich gerichtet und die Leute kümmern sich darum, dass ich nicht falle.
Auf einer Tour gibt es allerdings immer fünf oder sechs Momente, in denen jemand mir etwas Seltsames antun möchte. Wie zum Beispiel ein grosses Stück Kaugummi in mein Haar kleben, so dass ich danach die Haare schneiden muss!
Thomas, vielen Dank für das Interview!
Interview: Anna Wirz