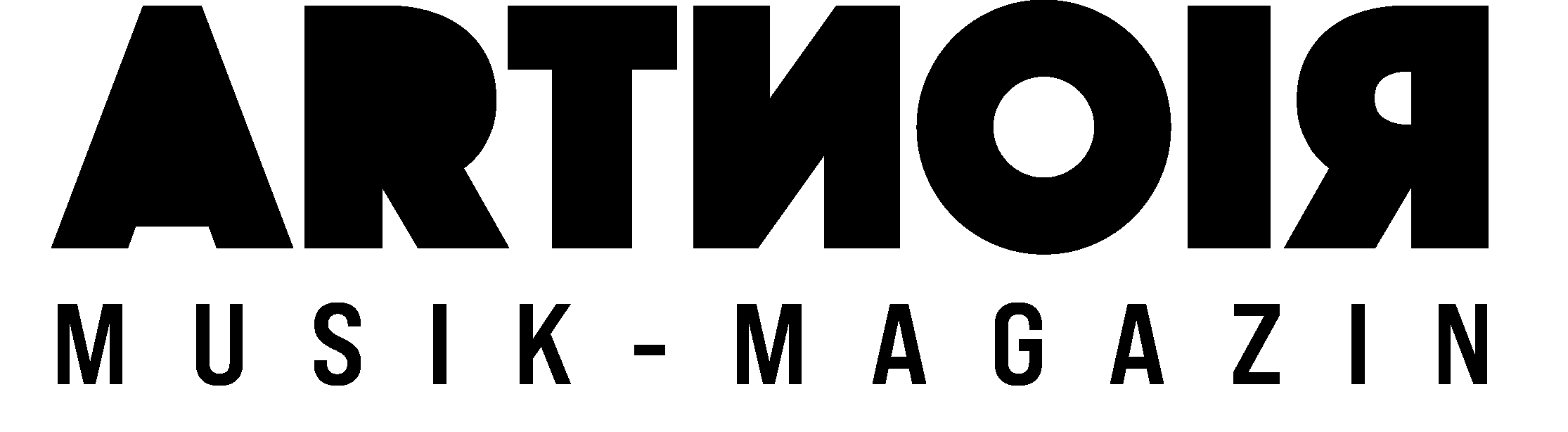©Pooneh Ghana
17. August 2020
Im Gespräch mit: Dave Bayley (Songwriter, Sänger, Gitarrist, Multiinstrumentalist) von Glass Animals.
Das neue Album „Dreamland“ der englischen Indie-Pop-Band Glass Animals ist eine Reise durch die Traumwelten von Komponist und Sänger Dave Bayley. Im Interview spricht er über seine Ängste, seine bislang ehrlichsten Songs zu veröffentlichen, und darüber, was seine Mutter damit zu tun hat.
David Kilchör: Euer neues Album begann eigentlich mit einem tragischen Unfall. Darf man das so sagen?
Dave Bayley: Es ist schon so. Der schwere, lebensbedrohliche Unfall von unserem Drummer und meinem guten Freund Joe Seaward hat mich aus der Bahn geworfen. Mein Blick auf die Zukunft war sehr dunkel. Das war das Szenario, das mich für die neuen Songs inspiriert hat.
Das Resultat klingt nun aber überhaupt nicht dunkel. Vielmehr bunt und positiv. Wie ist das möglich?
Ich kann kein Album voller Traurigkeit machen. Nicht, weil ich nicht dazu fähig wäre, sondern weil ich denke, das würde wahnsinnig monoton. Traurigkeit an sich ist in den Songs aber stets enthalten. Ich finde, sie kommt viel stärker zum Tragen, wenn sie in einem unbeschwerten Umfeld auftaucht. Ich mag diesen Kontrast in allen Formen der Kunst. So wird Kunst mehrdimensional.
Deine Songs sind Träume, die aus der Reflektion im und ums Krankenhaus entstanden.
Es sind Tagträume, würde ich sagen.
Hat sich an ihnen etwas verändert, jetzt da sie der ganzen Welt gehören und nicht mehr nur dir?
Gute Frage. Ich glaube, sie sind durch die Veröffentlichung des Albums keine Träume mehr. Die Reaktionen von Fans und Medien haben sie in ein anderes Licht gerückt. Sie fühlen sich nicht mehr wie Träume an.
Was trugen deine Bandkollegen bei?
Das ist abhängig vom Song. Einige Songs sind bei mir im Studio entstanden, ohne dass sie allzu viel dazu beitrugen. Mit anderen konnten sie sich sehr gut identifizieren, brachten neue Ideen ein und veränderten sie damit auch.
Was sagte Drummer Joe, als er die Kompositionen hörte – im Wissen darum, dass sein Drama der Auslöser war?
Einerseits war er etwas traurig, weil er aufgrund seines Zustandes nicht so viel Schlagzeugparts beisteuern konnte, wie er es gerne getan hätte. Andererseits hat er mich ermutigt und war eine moralische Stütze für mich. Das sind meine bislang persönlichsten Songs und ich war zutiefst verängstigt, sie zu veröffentlichen. Er sagte, genau darin liege die Stärke der Kompositionen.
Siehst du das mittlerweile auch so?
Je nach Perspektive, die ich gerade einnehme. Auf der einen Seite überlegte ich, welche Songs am meisten zu mir selber sprechen. Nehmen wir Brian Wilson. Seine Songs sind stets von tiefer Schönheit geprägt, zugleich auch unglaublich offen und ehrlich. Die Schönheit spricht mich doppelt an, weil ich mich auch inhaltlich von ihm verstanden fühle. Ich begriff, dass das den Fans der Glass Animals wohl auch so geht.
Andererseits?
Andererseits fühle ich mich nackt beim Gedanken an die veröffentlichten Songs, was sehr unangenehm sein kann. Umgekehrt stellte ich – gerade auch wenn ich an Brian Wilsons Musik denke – fest, dass ich nichts zu verbergen habe. Ich schrieb früher hauptsächlich Songs über andere Menschen, weil meine Mutter immer sagte, es sei nicht gut, zu viel über sich selber zu sprechen. Viel wichtiger sei, dass es den anderen um mich herum gut gehe. Aber die Ehrlichkeit, die ich manchmal in Songs finde, hilft mir, mich selber weniger einsam zu fühlen. Und so kann ich letztlich vielleicht auch anderen dabei helfen, dass es ihnen gut geht – indem ich über mich selber spreche.
Auf dem letzten Album hattest du aber auch schon sehr ehrliches Material. „Agnes“ etwa.
Ja, den Song wollte ich zunächst gar nicht aufs Album packen, weil er mir zu ehrlich war und ich mir egoistisch vorkam, über mich selbst zu singen. Aber auch da war es Joe, der mich antrieb. Und die Reaktionen auf den Song ermutigten mich, diesen Weg weiterzugehen.
Als ich „Agnes“ mal mit einer Band coverte, stellte ich fest, wie komplex die Komposition mit ihren rhythmisch verschobenen Klangebenen ist. Dabei klingt auf Anhieb alles so flüssig und eingängig. Wie gingst du da vor?
Ich liebe es, komplexe Sachen zu komponieren, die einfach klingen. Ich finde den Gedanken schön, strukturelle Details zu verstecken, die von den meisten Zuhörern gar nicht erkannt werden, aber einige wenige entdecken sie dennoch. Bei „Agnes“ standen zunächst der Text, die Melodie und die Akkorde. Ich bin überzeugt, dass das am besten für einen Song ist. Danach kann man rhythmische Schichten hinzufügen oder wegnehmen und herumbasteln, bis die Balance zwischen Inhalt und Arrangement stimmt. Ich mag den Aufbau in einem Song: mit wenig beginnen und dann neue Ideen aufschichten, lauter und wilder werden, vielleicht sogar den Song am Ende zerstören.
Auf dem neuen Album begehst du etwa in „It’s All So Incredibly Loud“ diesen Weg. Dem Titel zum Trotz beginnt der Song sehr leise. Weshalb?
Kennst du das, wenn du jemandem etwas enorm Schwieriges, vielleicht sogar Verletzendes gesagt hast, das aber gesagt werden musste? Zwischen deinem letzten Wort und der Antwort deines Gegenübers gibt es ein paar Sekunden Stille. Doch die Stille ist hochexplosiv, voller Emotionen, unglaublich laut eben. Der Song braucht deshalb beides: Die leisen Klänge und dann die Steigerung ins unerträglich Laute.
Ganz zu Beginn spielst du nur für wenige Takte einen Beat ein, den du dann wieder ausblendest. Danach kommen die Drums erst in der Hälfte des Songs wieder ins Spiel. Weshalb hast du das gemacht?
Der Song war wahnsinnig schwierig für mich, weil er einer der traurigsten auf dem Album ist. Ich hatte die ganzen Ebenen beisammen, aber komplett ohne Drums. Die Synthesizer sind recht perkussiv. Eigentlich wollte ich es dabei belassen, war aber unzufrieden mit dem Resultat. Irgendwann beschloss ich, doch noch einen echten Beat einzubauen. Ich lehnte mich zurück, hörte mir die neue Version an, und plötzlich war das Gefühl da, dass der Song funktioniert. Dass ich diesen Beat anfangs kurz anklinge, hat mit einem Narrativ zu tun, das ich mag. Der Songtitel sagt in diesem Fall ja ohnehin schon, wohin das Arrangement führt – zu Lärm. Mir gefällt der Gedanke, schon zu Beginn des Songs einen Vorgeschmack auf dessen Ende zu geben.
Im Grunde machst du das auch über das gesamte Album gesehen ebenfalls. Die Eingangsmelodie im Startsong kehrt am Schluss des letzten Songs zurück und ist damit retrospektiv ein Vorgeschmack aufs Ende des Albums. Allerdings spielst du die Melodie am Schluss in einer tieferen Tonart. Steckt darin eine Botschaft?
Dasselbe Muster wie zu Beginn zu wählen gefällt mir ebenfalls vom Narrativ her, aber eher aus dem Gedanken eines Kreislaufs heraus. Du startest eine Reise. Bei der Eingangsmelodie habe ich auf dem neuen Album einen Flughafen im Kopf. Von dort aus gibt’s eine Achterbahnfahrt durch Hochs und Tiefs. Zum Schluss ist man wieder am selben Ort, die Reise beginnt von vorn.
Aber ein bisschen anders – mit neuen Erkenntnissen, respektive einer neuen Tonart.
Könnte man so sagen. Im Tonartwechsel habe ich allerdings keine beabsichtigte Botschaft eingebaut. Den Schluss spielen wir in E-Moll, einer Tonart, die ich sehr melancholisch, aber auch warm finde. Es passte von der Komposition auch einfach besser, als zur Anfangstonart zurückzuspringen, hat also auch rein technische Gründe. Aber viele Leute suchen Botschaften, wo ich gar keine geplant habe. Eigentlich ist es schön, wenn der Zufall in meinen Kompositionen zu philosophischen Einsichten der Zuhörer führt.
Bist du zufrieden mit den Reaktionen aufs Album?
Ich bin ehrlich gesagt immer noch wahnsinnig nervös deswegen. Aber meine Mutter mag das Album schon mal. Das ist mir wichtig. Sie mag alles, ausser ihre Stimme.
Ihre Stimme?
Diese Zwischensequenzen aus den Heimfilmchen. Sie hat diese Filme in meiner Kindheit gedreht und deshalb hört man sie darauf auch. Die Tonspur habe ich über instrumentale Zwischenteile gelegt. Sie sagt, sie hasse ihre Stimme da drauf.
Aber du hast sie einfach eingebaut, ohne zu fragen?
Doch, ich habe gefragt und sie sagte, ich solle sie zwingend wegmachen. Ich entgegnete: Dich überzeuge ich jetzt innert einer Stunde davon, dass deine Stimme notwendig ist.
Und eine Stunde reichte tatsächlich dafür?
Ja, aber es war eine intensive Stunde. Ich schickte die Sequenzen auch ihrer Schwester und Freunden, und alle bombardierten sie mit Telefonaten, sagten, dass die Stimme da drauf bleiben müsse, dass das super klinge. Am Ende war sie einverstanden, aber glücklich ist sie immer noch nicht darüber.
Weshalb war das so wichtig für dich?
Wenn sie nach dieser Stunde nicht einverstanden gewesen wäre, hätte ich die Stimme rausgenommen. Anfangs waren das reine Instrumentalübergänge. Aber sie fühlten sich leer an, bedeutungslos. Dann fügte ich ihre Stimme hinzu und plötzlich waren sie voller Leben. Mir war wichtig, dass es meine Mutter ist, weil sie der einzige Mensch in meinem Leben ist, der immer da war. Eigentlich ist „Dreamland“ ihr gewidmet. Im Notfall hätte ich eine andere Stimme genommen, aber das wäre sehr schade gewesen.
Das Album ist fertig, dein Kopf wahnsinnig kreativ. Was nun?
Für mich ist die Veröffentlichung eines Albums eher dessen Beginn als dessen Ende. Ich habe tatsächlich viele Ideen. Als Erstes werden ein paar Kollaborationen aus den neuen Tracks entstehen. Dann wollen wir die Songs live inszenieren, aber auch nicht vollständig live – mit ganz neuen digitalen Ideen und Methoden. Auf diese Shows bin ich sehr gespannt. Ach, und ich würde gerne deine Cover-Version von „Agnes“ hören.
Oh, die gab’s nur einmal live – weiss nicht, ob eine Aufnahme davon existiert.
Wenn du sie findest, schick sie mir!
Interview: David Kilchoer