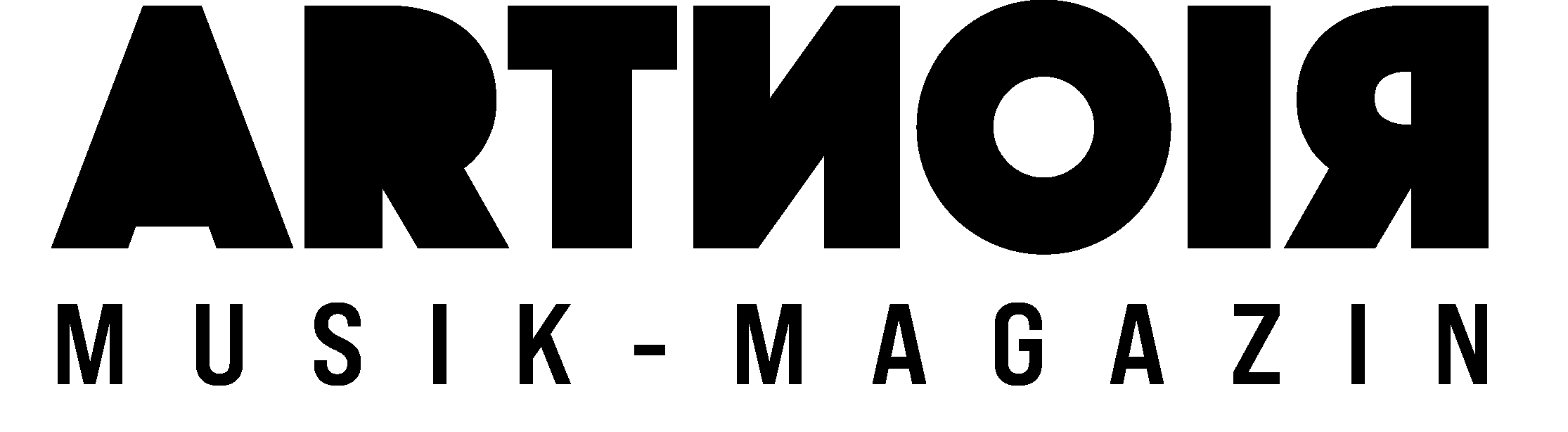Dead Oceans / VÖ: 19. Juni 2020 / Indie, Singer-Songwriter
Dead Oceans / VÖ: 19. Juni 2020 / Indie, Singer-Songwriter
phoebefuckingbridgers.com
Text: Michael Messerli
Es ist gesund, sich immer ein klein wenig zu überschätzen, nicht zu hart mit sich selber ins Gericht zu gehen. Optimismus und Hoffnung seien deshalb gute Wegbegleiter, auch wenn sie unbegründet sind. Hat man einmal hinter diese Maske geschaut und ein bisschen zu lange damit verbracht, die Dinge genauer zu betrachten, kann aus einem hübschen Gesicht bald eine hässliche Fratze werden. Die Konturen verzerren und man ist nur noch einen Katzensprung von den Selbstzweifeln entfernt, die zur Selbstzerstörung führen. Man dekonstruiert die guten Dinge und hebt die schlechten auf ein Podest. Selektive Aufmerksamkeit, Depressionen. Es ist in der Musik ein allgegenwärtiges Thema. Mit Realismus hat das nicht mehr viel zu tun. Und diesen Realismus lässt sich auch nur ertragen, wenn man zur Selbstakzeptanz findet.
Das eigene Selbst ist gewissermassen unser Zuhause und Phoebe Bridgers hat, wie die meisten von uns, Leichen im Keller, die sich als Untote im Unterbewusstsein bemerkbar machen können: „All the skeletons you hide/Show me yours/And I’ll show you mine“. Diese Rezension ist keine Psychoanalyse der Musik auf „Punisher“ oder der Person, die sie erschaffen hat. Einerseits nicht, weil die Psychoanalyse, so hartnäckig sie sich halten mag, längst überholt ist und andererseits nicht, weil – so trivial das klingen mag – Musik immer auch Raum für Interpretationen lässt. Phoebe Bridgers ist aber im Grunde recht transparent. Und deshalb kann man sich auch so gut mit ihrer Musik identifizieren. Man versteht, wovon sie singt.
Sie singt vom Umgang mit sich selber. Und Ryan Adams war ein sehr schlechter Umgang für Phoebe Bridgers, der ihre „Motion Sickness“ verursachte. Da ist Conor Oberst der weitaus bessere Sparringpartner und der Einfluss von Bright Eyes lässt sich auf „Punisher“ nicht mehr abstreiten. Mit Elliot Smith kann sie leider nicht zusammenspannen, aber für eine imaginäre Konversation reicht es im Titeltrack allemal. Ein Titeltrack, der nicht ohne Grund „Punisher“ heisst, weil Bridgers sich hier als einen etwas zu aufdringlichen Fan bezeichnet. Leider lebt Smith nicht mehr. Über die Themen Selbstwert und Selbstwahrnehmung hätte aber auch er sicher noch einige Lieder zu singen gewusst.
Der Tod war schon immer Teil von Bridgers Solo-Werk. Auf diversen Bildern rund um das Album, im Video zu “Kyoto“ sowie auf dem Cover sieht man sie stets mit einem Skelett-Kostüm. Ein Song heisst „Halloween“. Damit schafft sie es, dem Album ein Bild zu geben. Auf ihrem Debüt „Stranger In The Alps“ waren es die Geister. Das Talent dieser jungen Frau steckt nicht nur in ihrem Innenleben und damit in ihren fantastischen Songs, sondern in der ganzen Architektur. Dazu kommt eine ordentliche Portion Selbstironie. Wahrscheinlich auch, um den Selbsthass zu mildern. Es mit sich selber auszuhalten, ist eine existenzielle Aufgabe. Die Künstlerin aus Los Angeles wird noch ein Weilchen daran arbeiten müssen, hat aber mittlerweile die richtigen Freundschaften dafür. Lucy Dacus und Julien Baker sind entsprechend auch auf „Punisher“ zu hören. Es ist ein ruhiges Album, das mit jedem Detail immer mehr ans Herz wächst und seine ganze Grösse erst dann zeigen wird, wenn es sich bei dir zuhause eingerichtet hat.