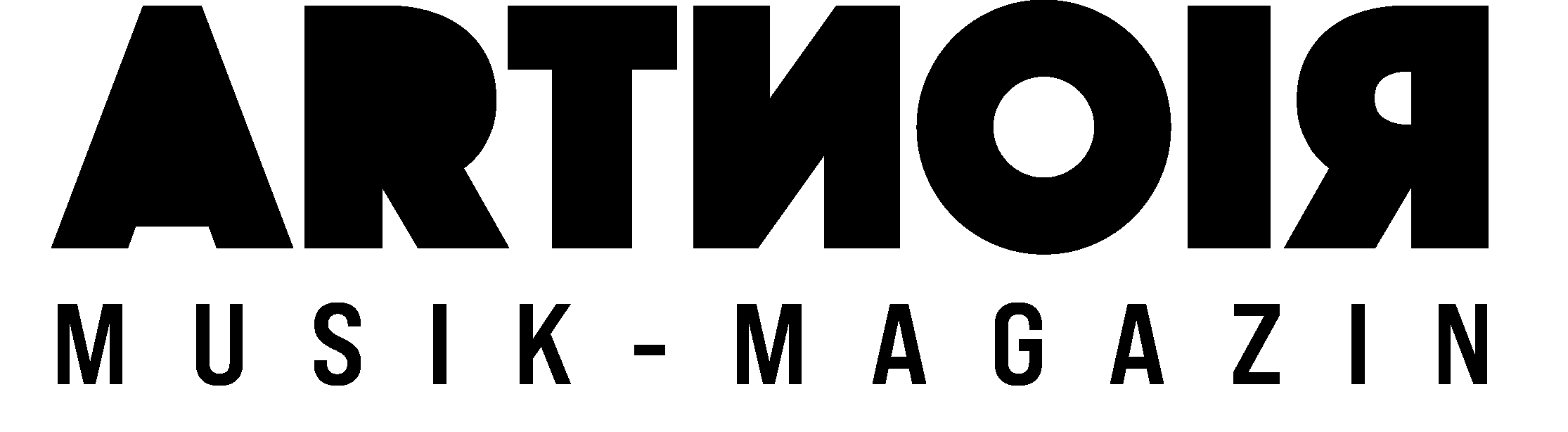17. August 2018
Im Gespräch Mit: Robert Gwisdek (Sänger) von Käptn Peng & Die Tentakel von Delphi.
Schön ist Winterthur und schön ist es, an den Winterthurer Musikfestwochen zu sein. Dem stimmt auch Robert Gwisdek zu, der zu spät zum Interview erschien, da er sich – natürlich ohne Handy – in der Altstadt verlaufen hat. Barfuss und ein bisschen verpennt berichtet der Schauspieler, Buchautor und Musiker von seinen musikalischen Vorbildern, die Quelle seiner Ideen und ein magisches Zeitloch, welches ihnen für das Konzert am Abend mehr Spielzeit verschaffen solle.
Sarah: Ihr habt ja total viele Konzerte im Moment. Bleibt da überhaupt noch Zeit für irgendetwas anderes?
Robert: Ja, ich schreibe parallel. Und im Vergleich mit anderen Bands sind es gar nicht so viele Konzerte. Ich habe jetzt keine Zahl, aber viel ist es erst seit drei Wochen, davor war Monate nix.
Schreibst du wieder ein Buch, oder bezieht sich das Schreiben auf Songtexte?
Ne, ich schreibe was anderes, aber das ist noch geheim.
Was mich eigentlich am meisten interessiert: Woher kriegt ihr eure Ideen her? Gerade auch bei dir bei den Texten.
Naja, Ideen kriegt man ja nicht irgendwoher, die bestellt man ja nicht im Internet. Die kommen über Vorgänge, die man selber nicht so ganz verstehen kann. Ich weiss die ehrliche Antwort auf diese Frage nicht.
Musst du dich an einen bestimmten Ort oder in einen bestimmten Zustand versetzen, um für Eingebungen offen zu sein ? Oder überfallen diese dich einfach?
Die können einem überfallen, wenn man gerade total überfordert mit ganz vielen anderen Sachen ist und total im Chaos steckt. Und wenn man dann die totale Ruhe hat und nichts, was einen ablenken könnte, fällt einem nichts ein. Leider fragt dich die Inspiration nicht, wenn sie dich besucht, sie klingelt einfach während irgendeiner Uhrzeit. Du kannst sie noch nicht einmal wirklich einladen, nur warten, dass sie irgendwann vorbeikommt. Wie ein unliebsamer Verwandter.
Laufen denn die Gedanken in deinem Kopf auch so schnell wie in deinen Texten?
Manchmal ja, manchmal nicht.
Es ist ja auch so, dass man ziemlich viel in die Texte hineininterpretieren kann. Steckt da auch tatsächlich immer eine Bedeutung dahinter?
Ja, die Bedeutung ist unterschiedlich. Es gibt manche Bedeutungen, die sind weicher. In dem Sinne, dass sie eher eine Art von Gefühl ausdrücken, oder eine Stimmung, die aber stimmen muss, sozusagen repräsentieren. Oder die gezielt in die Irre führen, wie bei „Wobwobwob“ zum Beispiel, in dem viele Fachwörter vorkommen. Sagen wir mal 70% davon sind erfunden, oder zumindest verbundene Fachwörter. Ein semipermiabler symoplektischer Kreis zum Beispiel: Semipermiabel heist halbdurchlässig und symoplektisch ist, glaube ich, erfunden. Trotzdem aber baut es irgendwas auf, es repräsentiert dann quasi etwas Unbekanntes. Es ist nicht Quatsch, die Lösung ist nur unbekannt. Und das gibt es an vielen Stellen. Es gibt Songs, die haben eine ganz ganz konkrete Aussage und eigentlich könnte ich für jede Textzeile eine Bedeutung erklären. Es ist nicht einfach so ins All gegriffen, kein Dadaismus.
Ist es denn auch dein Ziel, etwas durch die Texte zu vermitteln?
Klar — manchmal schon, manchmal nicht. Oft hat es damit zu tun, dass ich mich selber über die Texte mit einem Thema beschäftige. Ich bin nicht so der Mensch, der das Gefühl hat, er muss jetzt Leuten was erzählen, was sie nicht schon selber wissen. Aber klar, es gibt bei manchen Texten den Wunsch, eine Inspiration in eine Richtung aufzumachen.
Du wirfst ja auch viele Fragen auf, findest du da auch selber Antworten dazu?
Ja, ich finde auch Antworten, wo ich aber lieber die Frage dazu formuliere, statt die Antworten aufzuschreiben. Weil ich glaube, dass man als Mensch zu einem gewissen Zeitpunkt immer nur sich selbst glaubt. Und dann ist die Frage fast wertvoller als die Antwort.
Ja, da ist sicherlich was dran.
Also, manchmal ist es auch sehr inspirierend, unterschiedliche Antworten zu bekommen und diese dann zu überprüfen in sich selbst, ob sie eine Resonanz hinterlassen. Aber auch da glaube ich, ist beides vertreten.
Wie ist es denn für dich, wenn du merkst, dass Andere eure Musik anders verstehen, als ihr sie vielleicht meint?
Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Manchmal stört es mich, aber mittlerweile … Wenn man sich jetzt wirklich einmal die Mühe macht, die Texte der drei Alben zu lesen, dann ist genug dabei, dass man die Möglichkeit hätte, ohne, dass ich noch irgendetwas dazu sage, sich ein Bild zu machen, das halbwegs stimmt. Und dadurch, dass ich ja absichtlich gerne auch ein bisschen was verrätsele, kann ich mich ja auch nicht beschweren, wenn jemand dann ein ganz anderes Bild mitnimmt. Ich finde das eigentlich schön.
Versteht denn die Band immer, was du meinst?
Ne (lacht). Es gibt eine wahnsinnig schöne Geschichte von einem Rocksong aus den 60er oder 70ern. Da ging’s um Marihuanakonsum, und der Sänger hat geschrieben im Refrain: „Excuse me while I kiss the sky“. Also „Entschuldigt mich, während ich jetzt gehe und den Himmel küsse“, im Sinne von: „Ich werde jetzt mal high“. Und alle haben verstanden: „Excuse me while I kiss this guy“. Deswegen dachten alle, es wäre einer der ersten grossen Hymnen für die Befreiung von homosexueller Liebe. Und das ist doch irgendwie schön. Ich glaube, die Band hat dies nie richtig geklärt, sondern einfach gesagt: „Okay, dann so.“ Oder bei „Parantatatam“, das ist ganz lustig, da ist der letzte Satz vom Refrain: „Etwas steht jetzt auf und wird sich nie wieder setzen.“ Und es kommen doch immer wieder Leute auf uns zu und sagen: „Ich mag ja den Song, aber warum soll man sich nie widersetzen? Es ist doch wichtig, sich zu widersetzen!“ (Lacht)
Wie läuft das denn bei euch ab, wenn ihr Songs schreibt? Kommt da immer zuerst der Text und der Rest entsteht dann drum herum?
Es ist tatsächlich abwechselnd. Manchmal sind das Riff und der Beat erst da, manchmal ist der Text erst da. Das wechselt sich ab. Manchmal findet sich beides so ein bisschen halb gleich, aber meistens ist eines von beidem zuerst da.
Ihr verwendet ja nicht nur typische Instrumente, ihr bastelt ja auch selbst irgendwas. Wie ist das zustande gekommen?
Wir haben mit der Bassdrum als Betonmischtrommel aus dem Baumarkt angfangen. Und dann kam Peter dazu, der Perkussionist, und hat dazu mit einer Snare und einem Dings gespielt und es klang plötzlich original wie ein Schlagzeug alles. Und wir wollten irgendwie den Schlagzeugsound nicht, wir hatten irgendwie ziemlich schnell das Gefühl von „ist doch irgendwie schade, immer Schlagzeug und jetzt was, was quasi wie Schlagzeug klingt, bloss sind es zwei Personen, ist doch auch sinnlos.“ Und dann haben wir bei Peter so ganz bisschen die Idee reingeworfen: „Ey, spiel doch so auf ‘nem Koffer und auf ‘nem Dings“, und dann hat er sofort Ja gesagt, am nächsten Tag kam er mit tausend Geräten wieder. Und dann hat sich das ziemlich schnell verselbstständigt, weil Peter selber total viel Spass daran hat, diesen Quatsch zu sammeln und auf irgendwelchen Besen und Bürsten und Kuchenblechen und Fahrradklingeln und Koffern und diesem ganzen Kram zu spielen.
Habt ihr Vorbilder, was eure Musik anbelangt?
Ne, es gibt Bands, die uns inspirieren, einfach, wie sie sind, wie sie spielen, wie sie da so rangehen. Das sind aber oft Musikrichtungen, die gar nicht unsere Musikrichtung sind. Also ich zum Beispiel, und auch Andere in der Band, finden die Liveshow von Faber total schön. Und die sind ja auch so ein bisschen trashiger in ihrem Aufbau, mit dem Posaunisten, der gleichzeitig sein Drumset spielt. Man kann aber auch zum Beispiel von Bilderbuch lernen, finde ich, wie die das live machen. Wir hören sehr viel Musik von sehr unterschiedlicher Natur und das meiste ist gar nicht so sehr Hip Hop. Deswegen inspirieren uns eigentlich vor allem Künstler, die ihr eigenes Ding machen und irgendwie gut darin sind.
Ihr veröffentlicht ja unter eurem eigenen Label. Was war der Anlass dazu?
Wir wollten nicht irgendwo anders hin (lacht). Wir hatten eh schon diesen Selbermach-Anspruch, dass wir alles selber machten: Die Videos selber machen, die Instrumente so komisch bestücken. Da dachten wir, wir ziehen’s gleich ganz durch und haben uns dann irgendwann einen Booker geholt, und der hatte schon selber so ein kleines Indie-Label, K&F – Kumpels & Friends –, der sitzt in Dresden, und wir haben ihn einfach aus Spass gefragt, wie es so sei, wenn man selber ein Label gründet. Und dann kannte er die Schritte schon und hat uns quasi da durchleiten können. So ist es entstanden.
Ist es viel Arbeit?
Naja, du brauchst halt eine Person, die einen Plan hat, bürokratisch. Und dann ist es nicht mehr so viel Arbeit, weil der vieles davon dann macht. Du musst dich halt mit bestimmten Sachen nicht so rumschlagen. Ist eigentlich fast praktischer. Wenn du’s jetzt wirklich als Band komplett alleine machen willst – wir haben halt noch eine Person, die der bürokratische Mastermind ist, dadurch geht es. Unser Perkussionist macht den Webshop, zum Beispiel, wir designen die T-Shirts selber, wir machen die Coversachen selber, wir oder ich mache die Videos alleine. Klar ist das mehr Arbeit, aber es ist auch viel mehr Freiheit darin vorhanden.
Aber das gibt ja dann auch viel zu diskutieren und zu besprechen.
Ja. Wir sind eine demokratische Band, auch im Songschreibeprozess. Das ist auf jeden Fall anstrengend, aber es lohnt sich.
Zum Konzert heute Abend: Habt ihr da irgendwelche Hoffnungen oder Erwartungen?
Wir hoffen, dass sich ein Zeitloch öffnet und aus den 45 Minuten, die wir nur spielen dürfen, plötzlich anderthalb Stunden werden. Weil 45 Minuten echt hart an der Grenze ist, da geht’s eigentlich gerade los – das ist ein bisschen schade. Und wir hoffen halt trotzdem, dass es irgendwie ein runder Abend wird und nicht irgendwie etwas aufreisst, dass dann gar nicht gefüllt werden kann.
Ist ja nicht das erste Mal für euch hier bei den Musikfestwochen.
Ne, wir waren schonmal hier, genau auf dieser Bühne auch, und es war sehr schön.
Ist auch eine superschöne Bühne.
Ja, ist irgendwie gemütlich mit den Häusern. Wie das wohl die Anwohner machen?
Die kriegen halt-
Geld?
Nein, nicht Geld, aber Gratiseintritte. Und die meisten Winterthurer finden die Musikfestwochen sowieso toll, und dann stört’s auch nicht.
Interview: Sarah Rutschmann