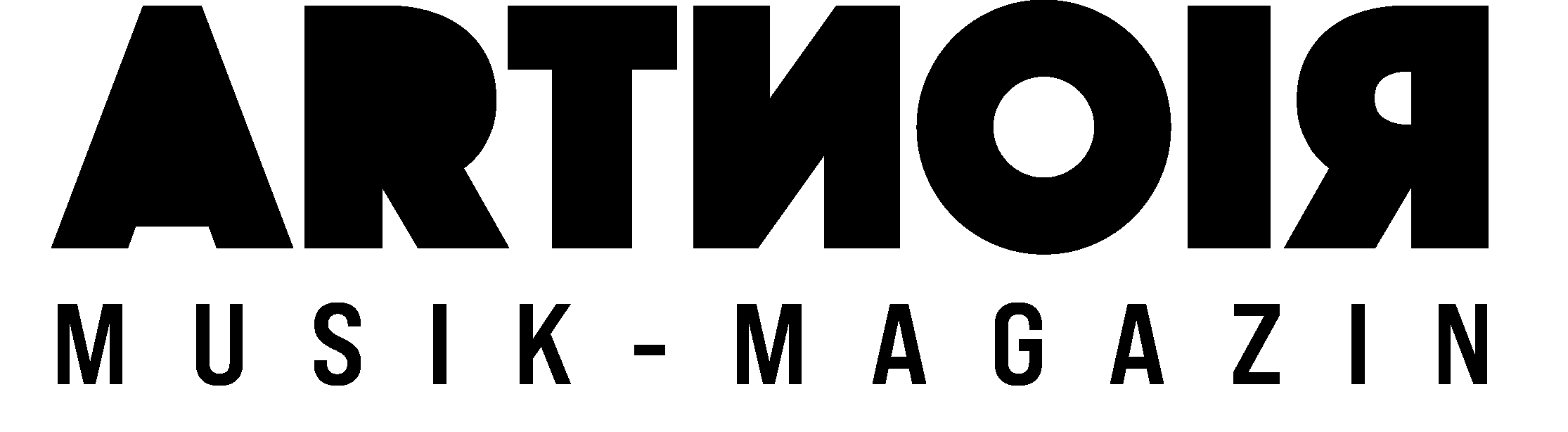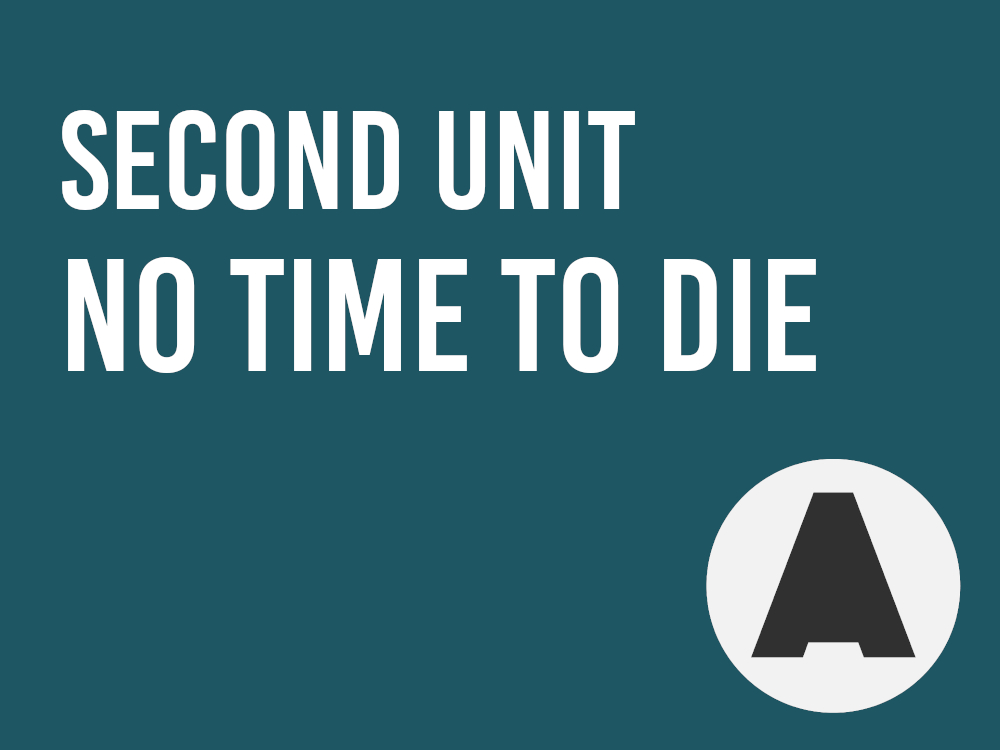
Second Unit – Die Filmkolumne
Text: Michael Bohli
Bond im 21. Jahrhundert
Oder, das missglückte Daniel-Craig-Experiment
Die Figur James Bond, welche seit den Anfängen der Sechzigerjahre über die Kinoleinwände der gesamten Welt hetzt, war nie ein Charakter mit Gewicht und Tiefe. Vielmehr diente der Agent des britischen Geheimdienstes dazu, weltpolitische und soziale Umstände der aktuellen Zeit als Projektionsfläche aufzunehmen und gewisse (will heissen, westliche) Interessen zu vertreten. Da fanden ausgefeilte Eigenschaften und Charakteristiken keinen Platz.
Geschickt durch Produzenten und Autoren aufgegleist, wurde die Reihe mit ihren Showeffekten innert kurzer Zeit zu einem globalen Erfolg, Bond durfte sich immer wieder von neuem mit megalomanischen Bösewichten, drohenden Katastrophen und hübschen Frauen herumschlagen und -schlafen. Ob der kalte Krieg, Machtgeplänkel zwischen Kolonialherrschaften und Länder der «dritten Welt», das Wettrüsten, der Kampf ums All, die rote Gefahr – England setzte sich, dank der sexistisch-gewalttätigen Kraft von Bond durch, Understatement und Charme inbegriffen.
In den Achtzigerjahren folgte der Bruch in Richtung Terrorismus, die darauffolgende Phase mit Pierce Brosnan tauchte in den Technologiewahn ein, neue Feinde und Bedrohungen erschienen – immer gemäss der Weltlage und den herrschenden Ängsten.
2006 wurde der Kurs verändert, Daniel Craig erbte nicht nur Anzug, Pistole und Nummer, sondern wurde das neuste Gesicht im ewigen Besetzungskarussell der Figur. Doch dieses Mal hatten die Macher*innen einen anderen Plan, das 21. Jahrhundert verlangte mehr emotional-psychologische Tiefe, ehemalige Ansichten und Handlungsweisen passten nicht mehr. Vorbei sind die Tage der Killermaschine, welche mit keckem Spruch und Martini in der Hand die ausländischen Gefahren über den Haufen schiesst. «Casino Royale», welcher die Reihe einem Reboot unterzog und versuchte, Bond ein Herz und menschliche Verletzlichkeit zu verleihen, war ernster, geerdeter und düsterer als das Wesen von 007 zuvor. Sogar bei Timothy Dalton herrschte mehr Überzeichnung.
Das war alles anders, funktionierte durch die sichere Inszenierung von Martin Campbell aber sehr gut und hätte als einzelner Film niemanden verunsichert. Doch bereits mit der direkten Fortsetzung «Quantum Of Solace» wurde klar, James Bond ist kein Mann für die kurzen Spässe, sein Herz wurde ihm entrissen, seine Liebe getötet. Die Figur wurde zu einer vernarbten Gestalt, die missmutig und von der Rache getrieben durch die Länder zieht – immer auf der Suche nach Vergeltung und Erlösung. «Skyfall» erfand eine Kindheit und Familiengeschichte, «Spectre» nahm das Brecheisen und versuchte retroaktiv alle Craig-Filme zu einer grossen Gesamtheit zusammenzuführen. Das JBCU, James Bond Cinematic Universe, sozusagen.
Ein Kniff, der in der heutigen Kinolandschaft oft angewandt wird, leider im Fall des 007 durch die fehlende Vision dazu führte, dass Figuren, Geschichten und ganze Film im Nachhinein abgewertet wurden. Der Reiz, sich mit Bond auf ein fesselndes Abenteuer zu begeben, das die Welt wie eine Karikatur aufzieht und am Schluss immer mit den «richtigen Siegern» endet, war dahin. Da die Masse aber weiterhin zufriedengestellt werden musste, suchte die grassierende Nostalgiewelle auch das Bond-Universum heim, spätestens beim Jubiläumsfilm «Skyfall» wurde mit Zitaten und Hinweisen nur so um sich geworfen.
«No Time To Die», der fünfte und letzten Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle, hat nun die undankbare Aufgabe, all diese losen Erzählstränge, Einzelteile der Struktur und ehemalige Aspekte der Streifen zu einem Finale zusammenzuführen. Dass die Maschine nicht mehr reibungslos läuft, war schon lange klar, mit dem aufgeblasenen, fast drei Stunden andauernden Werk taten sich die Macher*innen aber keinen Gefallen. Nicht nur wollte die Beziehung zwischen Bond und Madeleine Swann niemals Funken sprühen, die Geister von Spectre und Vesper Lynd mussten noch einmal dabei sein, Blofeld liess erneut seine Marionetten tanzen und zusätzlich brauchte es einen weiteren Endgegner. Viele Tränen, viele mürrische Close-Ups, etwas Bioterror und etliche leergeschossene Magazine – doch das Flair, die Aufregung, die waren dahin.
Egal wie stark man sich bemühte, den Zuschauer*innen mit Elementen wie dem Aston Martin DB5, Felix Leiter oder dem grossartigen Song von Louis Armstrong aufdringlich zu sagen, dass gerade ein Bond-Film über die Leinwand flimmert, es fühlte sich nicht mehr so an. Während andere Action-Serien wie «Mission:Impossible» oder in gewissen Teilen «Fast And Furious» die moderne Mischung aus Intimität und weitgespanntem Kräftemessen beherrschen, war dies nie das Wesen von 007.
Die Figur ist keine Person, sie ist das Relikt, eine Hülle, die in einer bestimmten Formel im Kino Sinn machte. Anstatt sich mit Brachialität an einer neuen und unpassenden Rezeption zu versuchen, hätte man die Reihe eventuell besser ruhen lassen sollen. James Bond ist ein Kind seiner Zeit, die Welt und Uhren haben sich weitergedreht.
Wie weiter also? Die wirtschaftlichen Aspekte verlangen natürlich, dass James Bond zurückkehren wird – wie es uns der Abspann von «No Time To Die» logischerweise versprach. Aber ist dies wirklich nötig? Kann man 007 wieder in bunten, atemlosen und fremden- / frauenfeindlichen Geschichten zeigen, nur um seinem Geist gerecht zu werden? Ist die Evolution mit einer weiblichen Inkarnation eine Lösung?
Meiner Meinung nach gibt es nur einen vernünftigen Entscheid: Man erfindet eine neue Figur, welche gewisse Aspekte der Filmreihe weitertragen wird, lässt in Zukunft Bonds Namen in der Schublade und sperrt seine Agentennummer. Dann vielleicht wird das erreicht, was vor 15 Jahren versucht wurde, als sich ein Schauspieler aus Chester weder um die genaue Art seines Drinks scherte noch nach den Regeln spielen wollte.
No Time To Die
Regie: Cary Joji Fukunaga
Musik: Hans Zimmer
Land, Jahr: USA und UK, 2021
Website: universalpictures.ch