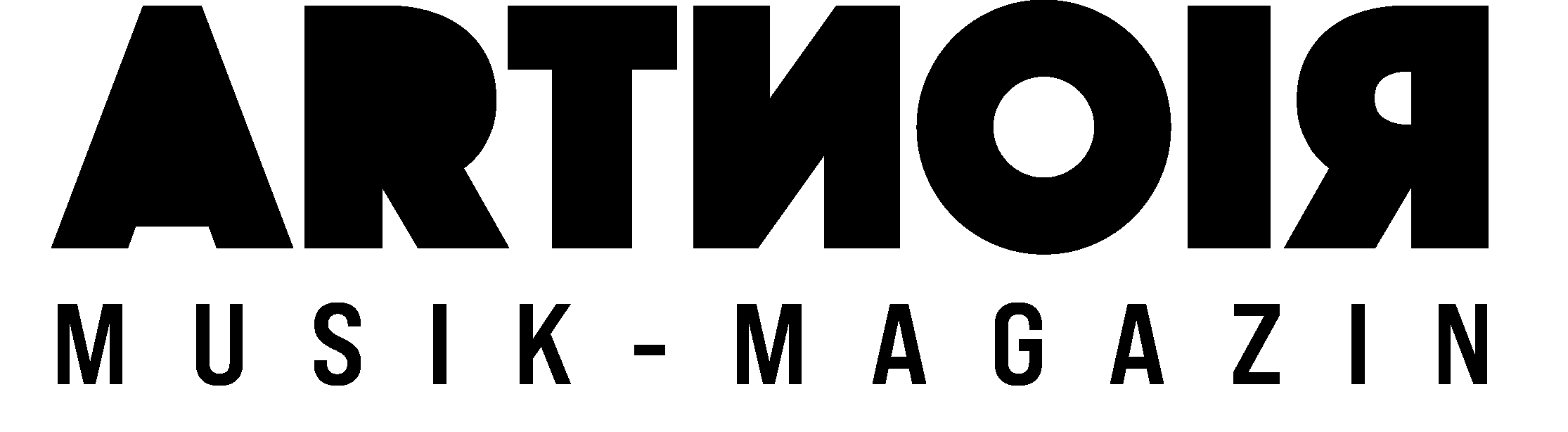Oh Boy Records / VÖ: 15. September 2023 / Folk-Rock
mickflannery.com
Text: Torsten Sarfert
Seine grössten Einflüsse sind laut eigener Aussage Kurt Cobain und Bob Dylan. Zum Einstieg in das neueste Album von Mick Flannery „Goodtime Charlie“ offenbart sich den aufmerksam Zuhörenden ein weiterer: Im Opener „Neon Tonight“ verbeugt sich der irische Songwriter mit feinstem „Blue-Eyed-Soul“ musikalisch vor dem ideologisch, politisch und religiös nicht immer ganz trittsicheren, legendären Van Morrison. Beide sind von der Insel, Flannery aus der Republik-, Morrison aus Nord-Irland. „Belfast Cowboy“ Morrison hatte ja auch schon immer eine Affinität zu amerikanischer Roots Musik und so ist dieser Einstieg auch passend zu Flannerys neuer musikalischer Heimat, dem von John Prine gegründeten Plattenlabel „Oh Boy Records“. Übrigens das erste nicht-amerikanische Signing des US-amerikanischen Labels überhaupt.
Der Sprung über den Teich ist damit vollzogen und Flannery schiebt mit dem Titelstück „Goodtime Charlie“ gleich eine deutlich rockigere Nummer nach. Diese riecht zwar nicht nach „Teen Spirit“, hätte aber auch gut auf Nirvanas „MTV Unplugged In New York“ gepasst. Ebenso unerwartet wie die rockigen Töne ist die Tatsache, dass der begnadete und mehrfach (auch in den USA) ausgezeichnete Songwriter neun der vierzehn Songs des Albums nicht wie üblich allein geschrieben hat. Auch eine Auswirkung der leidigen Pandemie, entstanden einige Songs in Zusammenarbeit mit Songwritern wie Ana Egge und Tony Buchen via Zoom und bescheren dem Album viel Abwechslung und obendrauf drei – ausschliesslich weibliche – Features. „Old Friend“ mit Tianna Esperanza, „The Fact“ mit Valerie June und „Minnesota“ mit Anaïs Mitchell.
Besonders hervorzuheben ist „The Fact“ mit Valerie June. Eine herzzerreissende, unfassbar traurige Ballade im Stile von Cave & Minogues „Where The Wild Roses Grow“. Mit dem Unterschied, dass hier nicht kranke Gewalt, sondern eine kranke Gesellschaft thematisiert wird. Springsteen könnte nicht ergreifender schreiben. Auch bei „Minnesota“ bleibt kein Auge trocken, wenn die amerikanische Singer/Songwriterin Anaïs Mitchell gemeinsam mit Flannery und zu sparsamer Pianobegleitung dessen Gedanken zur Ermordung George Floyds und dem Zustand der USA intonieren.
Zu übergrosser Form läuft der irische Barde jedoch bei „What They Say“ auf. Einer up-tempo Ballade und einer der drei Songs des Albums aus eigener Feder. Trotzig beschwingt und mit lyrisch-poetischen Worten über Himmel und Hölle. Da erinnert nicht nur das „Hallelujah“ an Leonard Cohen.
Ein Album zwar nicht wie aus einem Guss, dafür aber auf durchgehend höchstem musikalischen und textlichen Niveau (die beiliegenden Texte mitzulesen empfiehlt sich!) und einer Handvoll Songs, die das Zeug zu unvergleichlichen Klassikern haben. Trotz oder gerade wegen aller Einflüsse.
John Prine wäre sicher stolz auf den Label-Neuzugang aus der alten Welt. Nicht zuletzt weil der Mann aus Dublin auch gleich einen neuen Blickwinkel auf das Land der vermeintlich unbegrenzten Möglichkeiten mitbringt.
 |