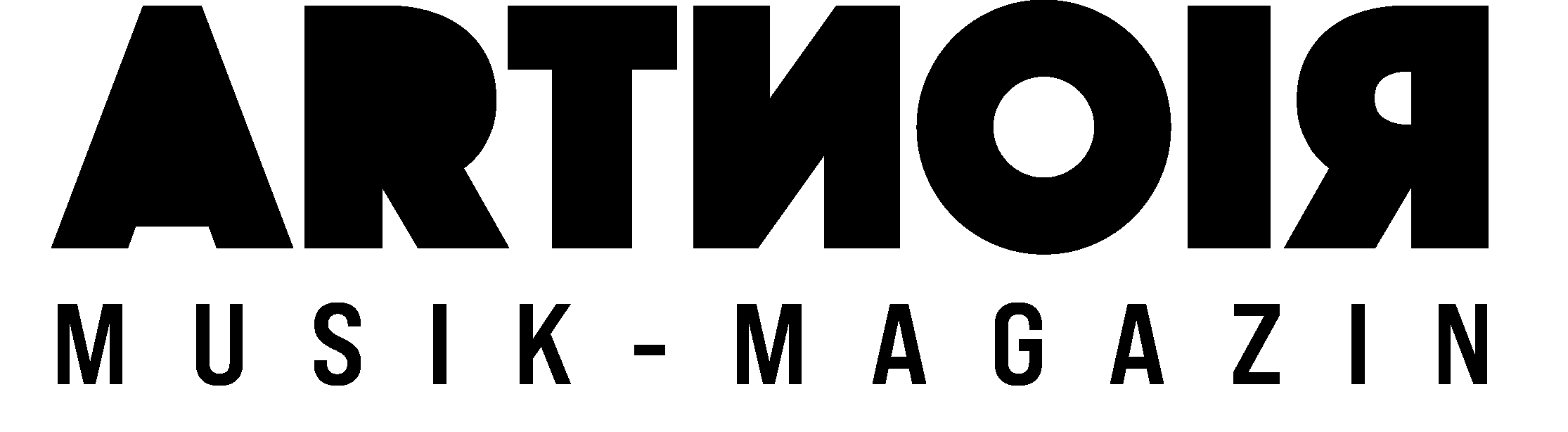Atlantic Records / VÖ: 11. Februar 2022 / Indie Rock, Art-Rock
altjband.com
Text: David Kilchoer
alt-J polarisieren, seit es sie gibt. Die Fans lieben ihren freien Zugang zu jeder Art von Klängen, Grooves und Stilen, wie sie diese vermengen und in ihre Kompositionen einpflegen. Die Kritiker sprechen ihnen Identität und Musikverständnis ab, bezeichnen ihr Oeuvre als nichtssagend, ihr Songwriting als leer. Was die Fans als Art-Rock huldigen, ist den Kritikern belanglos, beliebig.
Daran ändert auch das neue Album «The Dream» nicht viel. Das englische Trio tut in seiner Version eines Traums wenig Überraschendes – was bei einem Kompositionskonzept, das keine Wiedererkennung zulässt und damit die permanente Überraschung zum Status Quo beschwört, natürlich eine etwas harsche Aussage ist. Aber darin liegt die Krux von alt-J: Überraschung als Basis des Selbstverständnisses wirkt letztlich auch zufällig; und sie nutzt sich ab. Die Band kreiert Songs, als werfe sie rücklings zur Zielscheibe stehend Dartpfeile über die Schulter. Einige bleiben in der Dartscheibe stecken, einige fallen zu Boden – und nach einer gewissen Zahl von Würfen gibt’s automatisch auch ein paar Volltreffer. Man denke da etwa an «Left Hand Free» von 2014.
Eine gewisse Trefferquote weist auch alt-J’s neues Traumalbum auf. «U&ME» etwa, das im Vergleich zur allgemeinen Tonalität der Songsammlung zunächst wenig opulent beginnt. Die Basis ist ein fast unterbruchlos durchgelooptes Vier-Akkorde-Pattern auf der Gitarre. Darüber singt Bandleader Joe Newman ein paar kaum zusammenhängende Zeilen zum Thema «Summer Holiday, Having Fun». Mit zunehmender Songdauer füllt sich das zunächst feine Soundkonstrukt mit zusätzlichen Beats, Synthpads, Soundeffekten und Backgroundgesängen – und leert sich am Ende wieder. Das erinnert ein bisschen an Mobys Herangehensweise und ist damit zwar nicht sonderlich originell, doch Groove, Pattern und Melodie vereinen sich elegant zu einer treibenden Indie-Chill-Out-Nummer: mehr als solide alt-J-Kost.
Die hauptsächlich auf der akustischen Gitarre gezupfte Ballade «Get Better» hebt sich vom üppigen Sound des Albums erfrischend ab. Zwar wünschte man sich, das Trio hätte den Mut, die angeschlagene Tonalität für einmal bis zum Schluss durchzuhalten, doch als kurz vor Ende die akustische Gitarre abtaucht, um Pads und Klavier den Platz freizugeben, ist der Bruch zumindest nicht ruinös für den Song.
An derlei Brüche gewöhnt man sich ohnehin, während man sich weiter durchs Album hört. «Chicago» und «Philadelphia» etwa sind Aneinanderreihungen von Richtungsänderungen und Hard Stopps – sie hüpfen von reich befrachteten Arrangements, teils voll orchestriert, zu totaler Leere und zurück. Und so gelangt man über Stock und Stein zum Schlusstrack «Powders»: mit geringer Erwartung an Zugänglichkeit oder gar Gefälligkeit. Man sieht’s den Stream-Zahlen auf Spotify an: Die Absprungrate nach «Get Better» in der Mitte des Albums ist immens. Das ist bedauerlich, denn «Powder» ist so etwas wie die versteckte Perle des Albums.
Im Hintergrund rauscht das Meer, darüber fügen sich die drei Musiker zu einer seltenen Einheit zusammen. Die gestreichelten Drums, die zärtlich gedrückten Akkorde auf dem akustischen Piano, dazu die clean gespielte Gitarre – sie verschwimmen zu einer einzigen Klangfarbe. Die in dichte Gesangsharmonien gepackte Melodie verziert den Songbau wie Stuckaturen und verleiht der ansonsten schlichten Komposition einen Hauch von Prunk.
In diesem Ausklang steckt eine vielleicht unbewusste Botschaft. Wer sich nicht auf die Brüche der eigenwilligen Songbausätze einlässt, erhält am Schluss auch keine harmonische Konklusion. Oder wer alt-Js Traum nicht fertigträumt, erwacht womöglich schweissgebadet.