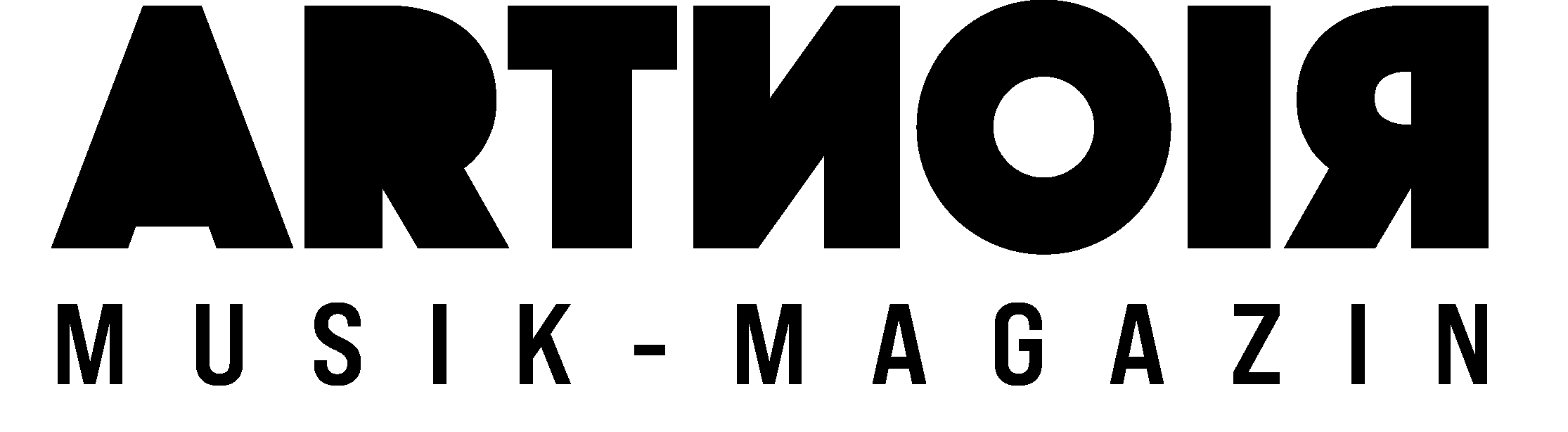17. April 2018
17. April 2018
Im Gespräch mit: David Hofmann (Bass, Gitarre und Synthies) und Urs Meyer (Gitarre und Piano) von Leech.
Ja, Leech haben mit ihrer instrumentalen Rockmusik so einige Leute tief bewegt. Umso schöner also, kehrt die Band aus dem Aargau in diesem Jahr endlich mit einem neuen Studioalbum zurück. Und bevor wir also in den neuen Songs versinken und die Mannen auf der Tour begleiten, hier ein paar Fragen zum aktuellen Zustand der Gruppe, der Aufnahmen und der Musikszene.
Michael: Unglaublich, aber wahr: Leech sind wieder im Studio. Wie fühlt sich das an?
Urs: Ungewohnt, wir waren sehr selten zusammen in den letzten Jahren. Die Zusammenarbeit hat sich sehr verändert, so sind wir weniger als komplette Band im Studio, sondern mehr als einzelne Elemente. Was bei den ersten beiden Platten noch als Gruppe aufgenommen wurde, das hat sich immer mehr aufgeteilt und wurde jetzt für das neue Album sogar noch extremer: Wir haben die neuen Songs am Computer vorproduziert, danach die einzelnen Instrumente aufgenommen, aber gar nie gemeinsam gespielt. Somit ist David als Produzent der einzige, der alle Bandmitglieder wirklich gesehen hat.
David: Die Verlagerung von Proberaum zu Studiotüfteleien geschah aus pragmatischen Gründen. Wir alle haben Jobs oder Familie, und es leben nicht mehr alle in der Region Zofingen – wodurch die Organisation immer schwieriger wurde. Und unsere Musik basiert nicht auf kurzen Songs, sondern wächst eher in epische Längen aus. Das lässt sich nicht einfach so schnell zusammen aufnehmen. Aber natürlich gibt es auch positive Seiten: Der Austausch findet nun halt via Internet statt und alle können sich so direkt eingeben.
Besteht dann aber nicht die Gefahr, dass der rohe Live-Aspekt der Aufnahme etwas verloren geht?
David: Seit „The Stolen View“ arbeiten wir eigentlich so, dass wir auch im Nachhinein noch sehr viel umarrangieren. So ist es ein natürlicher Prozess, in dem weiterhin beide Welten existieren. Wir planen momentan nebst den Arbeiten am Album noch eine Überraschung zum Jubiläum von „Instarmental“, die dann die rohe und direkte Seite aufzeigen wird. Wobei auch diese Songs über die Jahre gewachsen sind und die Liveform somit Sinn macht. Für uns ist es ein Qualitätsmerkmal, dass beides funktioniert und sich auch überschneidet.
Ist ein eigenes Studio denn eher ein Segen oder ein Fluch? Besonders, da Leech immer etwas mehr Zeit benötigen.
David: Meine Vermutung ist, dass es ohne dieses Studio wohl gar nicht funktionieren würde. Leech ist ökonomisch betrachtet schwierig zu rechtfertigen, weil alles viel Zeit braucht. Vor zwei Jahren haben wir fünf neue Songs aufgenommen, welche wir dann aber vor einem Jahr wieder komplett über den Haufen geworfen haben. Da unsere Band ein Herzensprojekt aus Leidenschaft ist, wollten wir uns nicht bloss wiederholen, sondern unsere Musik weiterbringen.
Urs: Dave sagt hier etwas sehr Wichtiges. Wir wollten uns immer verändern – was man auch sieht, wenn man „Instarmental“ und „If We Get There One Day, Would You Please Open the Gates?“ vergleicht. Der Klang ist ganz anders, auch wenn wir nur selten Alben aufgenommen haben. Und dies ist nun auch in den letzten sechs Jahren passiert. Wir sind nicht zufrieden, wenn wir zwar eine Wucht erreichen, aber klanglich stehengeblieben sind. Somit ist es auch positiv, dass wir ein „Heimstudio“ haben – so können wir auch Risiken eingehen.
Was ja gerade im Bereich Post-Rock, in dem Leech gelandet ist, eine grosse Gefahr darstellt: Die ewige Repetition.
Urs: Uns war es noch nie wichtig, einem Genre zugehörig zu sein. Leech funktioniert folgendermassen: Vor 20 Jahren hatten wir wenig technisches Material und kreierten aus jeder neuen Anschaffung einen Song. Wir sind keine Virtuosen an den Instrumenten, sondern nutzten immer die neuen Möglichkeiten wie Effektgeräte oder auch Computer, um weiter zu kommen. Das ist der rote Faden bei Leech – weniger eine bewusste Entscheidung, sondern eine natürliche Entwicklung.
David: Die Herausforderung ist halt immer, die Wirkung unserer Konzerte trotzdem erhalten zu können. Das verbindet alle Alben im Geiste, auch wenn sie sehr unterschiedlich klingen. Gerade mit dem Computer entstehen aber schon gewisse Gefahren.
Urs: Ja, mein Gefühl ist auch: Wenn Leech draufsteht, dann ist auch Leech enthalten. Ob dies nun mit drei Gitarren geschieht oder mit Computern – wir machen, was wir können und auch wollen. Der Ausdruck dieser Reisen, der Gefühle.
Apropos Reisen: Wird man auf eurem neuen Album denn auch Einflüsse von eurer Tour durch China spüren?
David: Chinesische Instrumente oder fernöstliche Melodien hatten diesbezüglich eigentlich keinen Einfluss. Wir haben dort auch nicht viel lokale Musik konsumiert. Mehr war aber das universelle Gefühl – besonders, da wir ohne Gesang Musik machen – dass unsere Spartenmusik in einem bescheidenen Mass überall funktioniert. Und dass wir mit weniger Equipment auskommen mussten. Das gab uns das Bewusstsein, dass alles auch mit sehr reduzierten Mitteln machbar ist.
Urs: Genau, musikalisch gesehen hat uns die Reise nicht beeinflusst. Ein Song ist in China entstanden, aber bloss, weil wir so viele Wartezeiten hatten. Eher passte unsere Musik perfekt dahin, in diese Landschaften.
 Plakative Botschaften gibt es in der instrumentellen Musik nicht. War euch das nie wichtig, oder arbeitet ihr mit unterbewussten Mitteln wie Songnamen?
Plakative Botschaften gibt es in der instrumentellen Musik nicht. War euch das nie wichtig, oder arbeitet ihr mit unterbewussten Mitteln wie Songnamen?
David: Die Songnamen haben immer eine gewisse humoristische Subnote, aber sonst arbeiten wir vor allem mit Stimmungen.
Urs: Absolut, ich glaube nicht, dass diese Band gerichtet funktioniert. Es ist eher eine Evolution. Diese Art von Musik hat im eigentlichen Sinne kein Ziel, wir wollen keine bestimmten Emotionen auslösen. Das muss einfach bei uns selber raus und verarbeitet werden, und das verpacken wir in Klänge. So gibt es Lieder, die entstehen innerhalb von etwa einer halben Stunde. Das sind meistens die besten. Dagegen stehen die Zangengeburten mit einer guten Grundidee, aber zu viel Lärm. Genau dieser momentane Ausdruck ist bei uns meist der Inhalt – und wenn sich Leute mit unserer Stimmungspalette identifizieren können, ist das wunderbar.
Was ja auch super funktioniert. Leech ist mit nur vier Alben eine ziemliche Legende geworden.
David: Das ist für uns vor allem im Ausland spannend, wenn wir erleben können, welche Leute unsere Musik mögen, ohne dass wir dort mit einem Label vertreten sind. So trifft man vom emotionalen Heavy-Metal-Fan bis hin zum K-Pop-Typen alles.
Urs: Das stimmt, Metal-Fans finden darin etwas, oder auch Hip-Hopper, welche Gefallen an einem Beat finden. Wir verpacken gewisse Gefühlsschwankungen, und das spricht je nach Phase verschiedene Fans an.
Demnach stösst ihr auf grosse Resonanz?
David: Ja, besonders durch die sozialen Medien. Die China-Tour oder der Festivalauftritt in Moskau sind so entstanden. Wir konnten es selber gar nicht wahrhaben, bis wir schliesslich dort waren. Das gab extreme Resonanz. Viele Leute kannten unser Material und es benötigte keine professionellen Institutionswege, um das zu ermöglichen. Ein grosser Vorteil der heutigen Vernetzung.
Wird Leech denn auch in 20 Jahren noch existieren, vielleicht mit einem sechsten Album?
Urs: Meine Prognose lautet ganz klar ja, auch weil wir nicht anders können und es brauchen. Jeder hat zwar sein eigenes Leben und Leech wurde immer auf kleiner Flamme gehalten – trotzdem war es immer sehr zentral. Und wenn es solche Dinge wie eine Tour in Asien ermöglichen, dann ist das wirklich schön und gibt einem viel fürs Leben.
Ist mit dem neuen Album eine Tour geplant?
Urs: Das Album ist schon ziemlich weit fortgeschritten und wir werden im September zuerst in Deutschland und Osteuropa Konzerte spielen. Anschliessend wird dann in Zürich die Plattentaufe stattfinden, und zwar am 15. September 2018 im Moods. Im November und Dezember werden wir in der Schweiz auftreten und im März 2019 folgt noch einmal Asien.
Wir sprachen vorhin über Herkunft: Leech stammt aus Zofingen. Wie konnten in dieser kleinen Stadt über all die Jahre immer wieder so viele interessante Bands entstehen?
Urs: Das ist eine gute Frage, das ist mir auch schon aufgefallen.
David: Ich denke, gewisse Mikrodynamiken, welche sich in einer Generation entwickeln, spielen eine grosse Rolle. Früher war beispielsweise der Ochsen ein sehr zentraler Punkt in Zofingen für Bands und Konzerte. Wobei früher der Horizont auch kleiner war, etwa bis Aarau oder Olten. Heute ist alles viel näher beisammen.
Urs: Das wird am Sidroga-Tee liegen! (lacht) Ich lebe nun schon seit Längerem in Zürich und empfinde Zofingen als sehr schön. Die Herkunft hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Person – und auch den Inputs, die man aus solchen Orten erhält. Schönheit gemischt mit Langeweile.
 Hört ihr denn selber andere Bands aus der Region?
Hört ihr denn selber andere Bands aus der Region?
David: Durch meinen Beruf habe ich einen gewissen Einblick, allerdings besuche ich immer seltener Konzerte. Wobei es heute für junge Bands auch immer schwieriger wird, Leute an einen Auftritt zu locken. Das Angebot ist einfach zu gross geworden, in allen Kunstbereichen.
Urs: Insofern, dass man Alessandro Gianelli auch zu einem gewissen Teil als Zofinger bezeichnen kann, muss ich sagen: Ich liebe Egopusher. Nicht nur, weil wir mit ihnen auf Tour waren, sondern weil mich solche Musik extrem anspricht.
Hört ihr denn privat vor allem instrumentale Musik?
David: Bei mir ist es zurzeit grösstenteils elektronische Musik. Für mich ist Musik auch immer ein Forschen nach Neuem – und im Rockbereich ist praktisch alles gesagt mit den vorhandenen Mitteln. Bei der Popgeschichte hatte immer die Technologie einen extremen Einfluss, was auch die Brücke zu Leech schlägt. Für mich findet man die grossen Innovationen momentan im elektronischen Bereich, im Clubbereich. Allerdings ist dies sehr schwierig in die klassische Livesituation zu übertragen. Die Rockstars der heutigen Zeit sind Teenager mit einem Laptop und Ableton.
Urs: Mein Musikgeschmack ist ambivalent. Ich höre sehr gerne minimalistische Klavierkünstler wie Max Richter oder Nils Frahm – andererseits kehre ich mit fortschreitendem Alter wieder zu meiner Jugend zurück. Zu Slayer, Sodom und dergleichen.
David: Was ist denn davon die Schnittmenge? Bon Jovi? (lacht)
Urs: Schlussendlich kehrt alles immer wieder zu Pink Floyd zurück. Der Klassiker. (lacht) Aber nein, momentan ist es für mich echt Slayer. Dazu liege ich auch gerne zwei Stunden in der Badewanne. Beim Reisen gefällt mit aber die instrumentale Musik sehr. Aber Post-Rock höre ich nicht, ich kenne praktisch keine Band aus diesem Gebiet.
David: Nein, dieses Genre kennen wir eigentlich gar nicht. Das fand ich immer so merkwürdig. Wir landeten mit «The Stolen View» damals unbewusst direkt in dieser Post-Rock-Flut, obwohl wir gar nicht eine solch intellektuelle Band sind wie die anderen. Wir sind eigentlich Post-Post-Pop.
Urs: Wir sind A Posteriori Rock! (lachen)
Zum Schluss noch: Wieso heisst ihr Leech?
Urs: Da gibt es verschiedene Versionen – die ehrliche: Es hat absolut keine Bedeutung. Damals haben mein Bruder (Marcel Meyer, Gitarre und Piano), Serge (Olar, Schlagzeug) und ich eine Band gegründet, weil Fussball nicht mehr aktuell war, noch mit einem Sänger und Bassisten. Und als wir unser erstes Konzert am 40. Geburtstag meiner Mutter gespielt haben, brauchten wir einen Namen. Also schlugen wir einen Duden auf und haben per Zufall ein Wort ausgesucht. Das war’s.
Urs: Und jetzt noch die Gegenfragen an den Journalisten. Was siehst du in Leech und wie gefällt dir die Musik?
Obwohl ich aus Zofingen stamme, bin ich diesbezüglich ein Spätzünder. Ich habe Leech erst durch „The Stolen View“ entdeckt, und ehrlich gesagt mag ich die beiden Alben davor nicht wirklich. Ich kam halt „leider“ damals durch den Post-Rock zu Leech und fand es interessant, wie anders ihr klingt. Und natürlich weil ihr aus Zofingen stammt – ich fand das immer sehr cool, eine solche Band hören zu können.
Vielen Dank für eure Zeit und Musik.
Interview: Michael Bohli